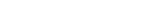Die Glücksspielbranche in Kroatien steht vor einer Zäsur. Anfang 2026 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das kaum einen Stein auf dem anderen lässt. Während die Regierung das Paket als konsequenten Schritt zum Schutz von Jugendlichen und gefährdeten Spielern feiert, befürchten Betreiber einen Kahlschlag, der den Markt schrumpfen lassen könnte.
In der Euphorie über mehr Kontrolle und Sorgen um Arbeitsplatzverluste bewegt sich eine Debatte, die spannender kaum sein könnte.
Ein Gesetzespaket, das vieles umkrempelt
Die Glücksspielreform ist nicht einfach eine Anpassung, sondern eine Generalüberholung. Ein zentrales Element ist die verpflichtende Identifikation. Wer künftig spielen will, muss sich registrieren lassen.
Gleichzeitig wird ein nationales Selbstsperrregister eingeführt, mit dem Betroffene sich selbst vom Spiel ausschließen können. Damit soll verhindert werden, dass problematische Spieler von einer Spielstätte zur nächsten ziehen.
Auch das Bild der kroatischen Städte wird sich verändern. Wettterminals in Cafés verschwinden, weil diese künftig verboten sind. Spielstätten wiederum dürfen nicht mehr in unmittelbarer Nähe von Schulen oder religiösen Einrichtungen liegen. Experten rechnen damit, dass bis zu 60 Prozent der Wettshops schließen oder den Standort wechseln müssen.
Eines bleibt allerdings erhalten: Glücksspiel bleibt weiterhin ein Angebot, das Spannung und Gewinnchancen verspricht. Legal betriebene Casinos und Wettanbieter sollen nach wie vor Echtgeld Gewinne möglich machen, allerdings in einem kontrollierten Rahmen, der Transparenz, Fairness und Schutzmaßnahmen miteinander verbindet. Der Nervenkitzel bleibt also, doch die Regeln rundherum werden strenger.
Auch die Werbung wird kräftig zurechtgestutzt. Zwischen sechs Uhr morgens und elf Uhr abends darf nichts mehr ausgestrahlt werden. Prominente, die bisher gern als Aushängeschild für Glücksspiele herhielten, verlieren diese Rolle. Das Ziel ist klar: weniger Anreiz für Jugendliche, sich von glitzernden Kampagnen verführen zu lassen.
Warum der Staat nun durchgreift
Die Gründe für den strikten Kurs liegen auf der Hand. Studien und Statistiken zeigen, dass in Kroatien bereits 73 Prozent der Jugendlichen mindestens einmal gespielt haben. Rund 13 Prozent zeigen problematisches Verhalten, was eine beunruhigende Zahl ist. Vor diesem Hintergrund hat die Politik eine nationale Strategie zur Prävention von Spielsucht bis 2030 beschlossen.
Die Regierung möchte damit gleich mehrere Baustellen bearbeiten. Einerseits geht es um den Schutz Minderjähriger, andererseits um die Regulierung eines Marktes, der sich in den letzten Jahren stark ausgebreitet hat.
Dass Glücksspiel steuerlich lukrativ ist, spielt selbstverständlich auch eine Rolle. Doch im Vordergrund steht die Botschaft, dass die Gesellschaft nicht länger die Augen vor den Schattenseiten verschließen will.
Welche Maßnahmen zur Suchtprävention greifen sollen
Die Reform bleibt nicht bei Verboten stehen, sie geht weiter und setzt auf Prävention. Geplant ist eine bessere Früherkennung von problematischem Verhalten. Psychologische Beratungsstellen sollen gestärkt und leichter erreichbar werden. Gleichzeitig wird Medienkompetenz stärker gefördert, damit junge Menschen lernen, Werbung kritisch zu hinterfragen. Ein spannender Punkt ist der Einsatz von Technologie. Künstliche Intelligenz soll helfen, auffällige Muster zu erkennen. Wer etwa ungewöhnlich häufig spielt oder hohe Summen setzt, könnte frühzeitig identifiziert werden. Ob das in der Praxis funktioniert, wird sich zeigen, doch es markiert den Versuch, moderne Werkzeuge in den Dienst der Prävention zu stellen.
Folgen für Spielstätten, Betreiber und Beschäftigte
Für Betreiber klingt das Gesetz weniger nach Fortschritt, sondern eher nach Existenzangst. Bis zu 60 Prozent der Wettshops könnten verschwinden, weil sie die neuen Standortauflagen nicht erfüllen oder die wirtschaftliche Basis verlieren. Für viele kleinere Anbieter wird es schwer, sich im Markt zu halten.
Die Folgen für Beschäftigte sind nicht zu unterschätzen. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, ganze Regionen könnten von Schließungen betroffen sein. Die Branche warnt zudem vor einer Marktkonzentration, in der nur noch große Unternehmen überleben. Das wiederum könnte die Vielfalt verringern und für Spieler weniger Auswahl bedeuten.
Steuerreform als zweischneidiges Schwert
Neben der Marktstruktur greift die Reform auch tief in die steuerliche Landschaft ein. Bisher wurden pauschale Abgaben erhoben, künftig wird ein progressives Steuermodell eingeführt. Gewinne bis 1.500 Euro sollen mit zehn Prozent belegt werden, höhere Gewinne steigen stufenweise bis auf 30 Prozent. Dazu kommen deutlich höhere Lizenzgebühren für Betreiber.
Die Regierung erwartet dadurch Mehreinnahmen von 50 bis 70 Millionen Euro jährlich. Mindestens elf Prozent dieser Summe sind fest für Präventions- und Therapieprogramme vorgesehen.
Damit verknüpft sich ein Signal: Das Geld, das durch Glücksspiel in die Staatskasse fließt, soll nicht nur den Haushalt füllen, sondern gezielt in den Schutz gefährdeter Menschen investiert werden.
Für Betreiber bedeutet diese Steuerreform allerdings eine massive Belastung. Höhere Abgaben und Lizenzkosten treffen gerade kleinere Unternehmen hart. Während der Staat von steigenden Einnahmen ausgeht, rechnen viele in der Branche mit einem gefährlichen Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Regulierung.
Strenge Regulierung oder Überregulierung?
Kaum eine Reform kommt ohne Gegenwind. Kritiker warnen, dass ein zu strenges Regelwerk Spieler in die Arme illegaler Anbieter treiben könnte. Wenn legale Angebote teurer und unattraktiver werden, wächst die Versuchung, auf unlizenzierte Plattformen auszuweichen. Dort gibt es weder Jugendschutz noch verlässliche Kontrollen.
Hinzu kommt die Sorge vor Arbeitsplatzverlusten und einer weiteren Verengung des Marktes. Manche Beobachter sehen sogar die Innovationskraft bedroht, weil neue Ideen kaum Platz finden, wenn Regulierungen zu eng gefasst sind.
Die Frage bleibt, wie fein die Balance gelingt. Wird Kroatien wirklich einen sauberen Markt schaffen oder führt die Reform dazu, dass die Schattenwirtschaft wächst?
Europas Blick auf Kroatien
Die Reform endet nicht an den Landesgrenzen, sie hat auch europäische Dimensionen. Kritiker werfen Kroatien vor, das sogenannte TRIS-Verfahren nicht ordnungsgemäß eingehalten zu haben. Dabei geht es um die Pflicht, neue nationale Regelungen rechtzeitig bei der EU-Kommission zu melden.
Wird dieser Vorwurf bestätigt, könnte ein Vertragsverletzungsverfahren drohen. Kroatien riskiert damit nicht nur juristische Komplikationen, sondern auch politischen Gegenwind aus Brüssel. Branchenverbände wie EUROMAT haben bereits öffentlich Einspruch erhoben und auf mögliche Konflikte hingewiesen.
Ein Blick auf andere Länder zeigt, dass die EU in der Vergangenheit durchaus einschritt, wenn nationale Gesetze nicht mit den Binnenmarktvorgaben harmonierten. Die Frage, ob Kroatien hier nachjustieren muss, bleibt also spannend.
Wie realistisch sind die Ziele der Reform?
Die Ziele klingen ehrgeizig: Schutz der Jugend, Prävention von Sucht, Eindämmung illegaler Anbieter und gleichzeitig höhere Einnahmen für den Staat. Doch wie realistisch ist es, dass all das gleichzeitig gelingt?
Chancen gibt es genug. Die verpflichtende Identifikation und das Selbstsperrregister können tatsächlich für mehr Kontrolle sorgen. Auch die Einschränkung von Werbung dürfte Jugendliche weniger stark in Versuchung bringen. Dazu kommt das zusätzliche Geld für Präventionsprogramme, das sinnvoll eingesetzt werden könnte.
Mögliche Szenarien für den Glücksspielmarkt in Kroatien
Wie geht es also weiter? Im optimistischen Szenario schafft Kroatien tatsächlich ein Vorzeigemodell: weniger problematische Spieler, stabile Einnahmen für den Staat und eine Branche, die zwar kleiner, aber gesünder ist.
Im realistischeren Szenario dürfte es Verbesserungen geben, doch nicht alle Ziele werden erreicht. Manche Betreiber verschwinden, illegale Angebote bleiben bestehen, und die EU könnte auf Korrekturen pochen.
Redaktion Service
Bild: unsplash.com