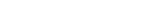Der europäische Branchenverband EUROMAT hat bei der Europäischen Kommission eine formelle Beschwerde gegen Kroatien eingereicht. Der Verband, der zahlreiche Glücksspiel- und Automatenbetreiber in Europa vertritt, wirft der kroatischen Regierung vor, mit ihren jüngsten Gesetzesänderungen den europäischen Binnenmarkt zu unterlaufen. Konkret geht es um Vorschriften, die ausländische Anbieter benachteiligen und den Zugang zum kroatischen Markt erschweren sollen.
Die Beschwerde dürfte in Brüssel Gehör finden, denn das Thema betrifft weit mehr als nur die Glücksspielbranche. Es geht um die Frage, wie weit nationale Regierungen ihre Märkte regulieren dürfen, ohne gegen die Grundprinzipien der Europäischen Union zu verstoßen – insbesondere die Dienstleistungsfreiheit.
Umstrittene Lizenzen und nationale Schranken
Auslöser des Streits ist die kroatische Regelung, wonach Anbieter von Online-Glücksspielen eine physische Präsenz im Land nachweisen müssen, um eine Lizenz zu erhalten. Das bedeutet, dass Unternehmen aus anderen EU-Staaten, die bereits eine gültige Lizenz besitzen, zusätzliche Auflagen erfüllen müssen – etwa durch die Eröffnung einer Niederlassung in Kroatien.
Nach Ansicht von EUROMAT ist das nicht mit europäischem Recht vereinbar. Der Verband argumentiert, dass diese Vorschrift eine unzulässige Marktabschottung darstellt und gegen das Prinzip des freien Dienstleistungsverkehrs verstößt. „Kroatien schafft künstliche Hürden, die den Wettbewerb verzerren“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.
Die Branche steht in den vergangenen Jahren ohnehin unter Druck. Der europäische Online-Glücksspielmarkt wächst dynamisch – allein 2024 wurden laut der European Gaming and Betting Association (EGBA) rund 38 Milliarden Euro Umsatz erzielt, ein Plus von knapp 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kroatien hat daran zwar nur einen kleinen Anteil, doch die Tendenz ist steigend. Besonders stark wachsen derzeit die brandneuen Online Casinos, die mit modernen Plattformen, Live-Spielen und digitalen Zahlungsmethoden Kunden anziehen.
Regulierung zwischen Schutz und Abschottung
Die kroatische Regierung verteidigt ihre Regeln mit dem Hinweis auf den Spielerschutz. Man wolle Missbrauch verhindern und sicherstellen, dass Anbieter sich an nationale Vorgaben halten. Offiziell geht es auch um Maßnahmen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Kritiker sehen in der Argumentation jedoch einen Vorwand. Hinter der Fassade des Spielerschutzes, so heißt es aus Branchenkreisen, stecke der Versuch, den heimischen Markt vor Konkurrenz zu bewahren. Tatsächlich profitieren vor allem lokale Unternehmen, die bereits stationäre Spielhallen oder Wettbüros betreiben. Für internationale Anbieter wird der Markteintritt dagegen teurer und aufwendiger – mit entsprechend geringeren Chancen.
Rechtsexperten erinnern an frühere Fälle: Bereits 2017 hatte die EU-Kommission ähnliche Verfahren gegen mehrere Mitgliedsstaaten eingeleitet, darunter auch Ungarn. In fast allen Fällen mussten die betreffenden Länder ihre Vorschriften anpassen, um EU-konform zu bleiben. Auch Kroatien könnte nun unter Druck geraten.
Eine Studie des European Centre for Gambling Studies (ECGS) zeigt zudem, dass Länder mit offenen Lizenzsystemen langfristig bessere Ergebnisse erzielen – sowohl beim Spielerschutz als auch bei Steuereinnahmen. Staaten wie Malta oder Dänemark, die auf transparente Verfahren setzen, verzeichnen laut der Untersuchung zwischen 12 und 18 Prozent mehr legale Umsätze als Länder mit restriktiven Vorgaben.
Reaktionen und mögliche Folgen
In Zagreb reagierte das Finanzministerium zunächst zurückhaltend. Man prüfe die Beschwerde, hieß es auf Anfrage. Inoffiziell wird aber eingeräumt, dass die Auflagen für Online-Betreiber bewusst streng formuliert wurden. Dahinter steckt offenbar auch die Sorge, den Markt zu schnell für internationale Konzerne zu öffnen.
Auf europäischer Ebene sorgt der Fall inzwischen für Aufmerksamkeit. Innerhalb der Kommission wird die Beschwerde ernst genommen, heißt es aus Brüsseler Kreisen. Sollte ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet werden, müsste Kroatien nachweisen, dass seine Vorschriften verhältnismäßig und notwendig sind – was juristisch nicht einfach wäre.
Gleichzeitig zeigt die Auseinandersetzung, wie sehr sich die Glücksspielbranche in einem Wandel befindet. Immer mehr Umsätze verlagern sich ins Internet, und der Anteil des Online-Sektors wächst auch in Kroatien rasant. Nach Angaben der nationalen Regulierungsbehörde liegt der Marktanteil des digitalen Glücksspiels mittlerweile bei etwa 30 Prozent. Rund 400.000 Kroaten nutzen regelmäßig Online-Plattformen, Tendenz steigend. Bis 2026 könnte der Markt laut Prognosen auf ein Volumen von 650 Millionen Euro anwachsen.
Damit wird deutlich, warum die Regeln derzeit so umkämpft sind. Für die Regierung geht es um Kontrolle und Steuereinnahmen, für die Branche um Zugang und Wettbewerbschancen. Beide Seiten wissen, dass es um viel Geld geht – und um politische Symbolik.
Ein europäischer Testfall
Die Beschwerde von EUROMAT könnte zum Präzedenzfall werden. Sollte die Kommission Kroatien tatsächlich auffordern, seine Gesetze zu ändern, würde das Signalwirkung für andere Länder haben, die ebenfalls über strengere nationale Vorschriften nachdenken.
In Brüssel gilt der Fall schon jetzt als heikel. Einerseits will die EU die Mitgliedstaaten nicht bevormunden, wenn es um Verbraucherschutz geht. Andererseits ist der freie Wettbewerb ein Grundpfeiler des Binnenmarkts. Wo die Grenze verläuft, ist schwer zu definieren – und genau hier liegt der Konflikt.
EUROMAT betont, es gehe nicht darum, nationale Regelungen abzuschaffen. Der Verband fordert lediglich, dass Anbieter aus allen EU-Staaten unter denselben Bedingungen tätig sein dürfen. „Wir wollen faire Chancen, keine Sonderrechte“, heißt es aus dem Verbandssitz in Brüssel.
Wie die Kommission entscheidet, ist offen. Erfahrungsgemäß dauern solche Verfahren Monate, oft auch Jahre. Doch unabhängig vom Ausgang zeigt die Beschwerde, dass die Branche an einem Wendepunkt steht. Zwischen Regulierung, wirtschaftlichem Interesse und europäischer Integration gilt es, eine Balance zu finden – und die ist schwerer geworden, als es auf dem Papier aussieht.
Redaktion Service
Bild: zVg.